 Die neun Sinfonien (auch: Symphonien) von Beethoven zählen wohl zu den berühmtesten Werken der klassischen Musik. Die meisten Sinfonien sind selbst einem ansonsten nicht an klassischer Musik interessierten Publikum bekannt. Vor allem bekannt geworden sind die Sinfonie Nr. 3 (op. 55, Es-Dur, die sog. Eroica-Sinfonie von 1804), die Sinfonie Nr. 5 (op. 67, c-Moll, die gelegentlich auch Schicksalssinfonie genannt wird, von 1808), die Sinfonie Nr. 6 (op. 68, F-Dur, die sog. Pastorale-Sinfonie von 1808) und die Sinfonie Nr. 9 (op. 125, d-Moll, nach ihrem berühmten Schlusschor auch gelgentlich Ode an die Freude oder auch Freude schöner Götterfunken genannt, 1824). Diese Sinfonien sind im 20. und 21. Jahrhundert eigentlich von jedem berühmten Dirigenten und mit jedem berühmten Orchester früher oder später einmal vollständig eingespielt worden. Auf Grund der Vielzahl an Gesamteinspielungen herrscht folglich bis heute keine wirkliche Einigkeit unter Kritikern, welche Aufnahme der Beethoven-Sinfonien als Referenzaufnahme zu gelten hat. Daher stellen wir in diesem Artikel drei Aufnahmen der Beethoven-Sinfonien vor, die alle einen berechtigten Anspruch auf den Titel ‚Referenzaufnahme‘ erheben können. Diese Aufnahmen seien damit Beethoven-Enthusiasten wie Klassik-Neulingen gleichermaßen empfohlen.
Die neun Sinfonien (auch: Symphonien) von Beethoven zählen wohl zu den berühmtesten Werken der klassischen Musik. Die meisten Sinfonien sind selbst einem ansonsten nicht an klassischer Musik interessierten Publikum bekannt. Vor allem bekannt geworden sind die Sinfonie Nr. 3 (op. 55, Es-Dur, die sog. Eroica-Sinfonie von 1804), die Sinfonie Nr. 5 (op. 67, c-Moll, die gelegentlich auch Schicksalssinfonie genannt wird, von 1808), die Sinfonie Nr. 6 (op. 68, F-Dur, die sog. Pastorale-Sinfonie von 1808) und die Sinfonie Nr. 9 (op. 125, d-Moll, nach ihrem berühmten Schlusschor auch gelgentlich Ode an die Freude oder auch Freude schöner Götterfunken genannt, 1824). Diese Sinfonien sind im 20. und 21. Jahrhundert eigentlich von jedem berühmten Dirigenten und mit jedem berühmten Orchester früher oder später einmal vollständig eingespielt worden. Auf Grund der Vielzahl an Gesamteinspielungen herrscht folglich bis heute keine wirkliche Einigkeit unter Kritikern, welche Aufnahme der Beethoven-Sinfonien als Referenzaufnahme zu gelten hat. Daher stellen wir in diesem Artikel drei Aufnahmen der Beethoven-Sinfonien vor, die alle einen berechtigten Anspruch auf den Titel ‚Referenzaufnahme‘ erheben können. Diese Aufnahmen seien damit Beethoven-Enthusiasten wie Klassik-Neulingen gleichermaßen empfohlen.
Beethoven-Sinfonien, Referenzaufnahme 1: Karajan (1961/62)
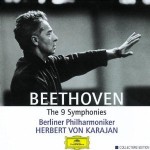 Wenn an dieser Stelle Karajans 60er-Jahre-Einspielung der Beethoven-Sinfonien als Referenzaufnahme erster Güte genannt wird, ist das eine nicht völlig unkritische Angelegenheit. Zumindest technisch sind die späteren Gesamtaufnahmen durch Karajan besser (1977 und 1985). Karajan war bekanntlich ein Perfektionist, der nicht nur musikalisch, sondern auch aufnahmetechnisch höchste Vollendung anstrebte. Während ihm letzteres in den späteren Aufnahmen gelang, muss man von der früheren 1961/62er-Aufnahme sagen, dass sie musikalisch unerreicht geblieben ist. Es ist Karajans erste GA mit den Berliner Philharmonikern (eine erste GA der Beethoven-Sinfonien machte Karajan 1954 mit dem Londoner Philharmonia Orchestra). Bei dieser 60er Jahre-Aufnahme sticht besonders die berühmte Aufnahme der 9. Sinfonie hervor, die mit Gundula Janowitz und Walter Berry solistisch ideal besetzt ist. Die meisten Kritiker waren sich in der Folge einig, dass diese Aufnahme eine wahre Referenzaufnahme sein müsse. So schreibt z.B. der Musikkritiker David Hurwitz, dass es einen „generellen Konsens“ gebe, dass diese Aufnahme die beste ihrer Art sei: „The Berlin Philharmonic was in top form, and they had not yet made an artistic fetish out of the bland smoothness that typified the conductor’s later recordings of this music.“
Wenn an dieser Stelle Karajans 60er-Jahre-Einspielung der Beethoven-Sinfonien als Referenzaufnahme erster Güte genannt wird, ist das eine nicht völlig unkritische Angelegenheit. Zumindest technisch sind die späteren Gesamtaufnahmen durch Karajan besser (1977 und 1985). Karajan war bekanntlich ein Perfektionist, der nicht nur musikalisch, sondern auch aufnahmetechnisch höchste Vollendung anstrebte. Während ihm letzteres in den späteren Aufnahmen gelang, muss man von der früheren 1961/62er-Aufnahme sagen, dass sie musikalisch unerreicht geblieben ist. Es ist Karajans erste GA mit den Berliner Philharmonikern (eine erste GA der Beethoven-Sinfonien machte Karajan 1954 mit dem Londoner Philharmonia Orchestra). Bei dieser 60er Jahre-Aufnahme sticht besonders die berühmte Aufnahme der 9. Sinfonie hervor, die mit Gundula Janowitz und Walter Berry solistisch ideal besetzt ist. Die meisten Kritiker waren sich in der Folge einig, dass diese Aufnahme eine wahre Referenzaufnahme sein müsse. So schreibt z.B. der Musikkritiker David Hurwitz, dass es einen „generellen Konsens“ gebe, dass diese Aufnahme die beste ihrer Art sei: „The Berlin Philharmonic was in top form, and they had not yet made an artistic fetish out of the bland smoothness that typified the conductor’s later recordings of this music.“
Hier geht es zur Referenzaufnahme der Beethoven-Sinfonien mit Karajan von 1962/63.
Beethoven-Sinfonien, Referenzaufnahme 2: Bernstein (1977-79)
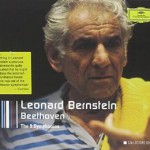 Bernstein und Karajan sind zweifellos Gegenpole und vermutlich werden Anhänger der Karajan-Einspielung die Bernstein-Aufnahme verteufeln und vice versa. Karajans oft beschworener emotionaler Kälte und Distanz setzt Bernstein eine romantisch-emotionalen Überfluss entgegen, der beim direkten Vergleich der beiden Aufnahmen (Karajan und Bernstein) den Eindruck aufkommen lässt, es handele sich um gänzlich unterschiedliche Kompositionen, die hier aufgenommen wurden. Bernsteins Aufnahme der Beethoven-Sinfonien mit den Wiener Philharmonikern von 1977-79 kann daher als eine Referenzaufnahme für eine besonders romantische Beethoven-Interpretation angesehen werden, lebhaft, dynamisch und ohne jeden Zweifel gelegentlich auch sehr überschwänglich. Dieser Überschwang macht sich v.a. in der Aufnahme der Eroica-Sinfonie bemerkbar, die selbst unbeteiligte Hörer mitreißen dürfte. Diese Aufnahme sei daher jedem Beethoven-Anhänger ans Herz gelegt, nicht zuletzt, weil sie auch klanglich Standards setzt.
Bernstein und Karajan sind zweifellos Gegenpole und vermutlich werden Anhänger der Karajan-Einspielung die Bernstein-Aufnahme verteufeln und vice versa. Karajans oft beschworener emotionaler Kälte und Distanz setzt Bernstein eine romantisch-emotionalen Überfluss entgegen, der beim direkten Vergleich der beiden Aufnahmen (Karajan und Bernstein) den Eindruck aufkommen lässt, es handele sich um gänzlich unterschiedliche Kompositionen, die hier aufgenommen wurden. Bernsteins Aufnahme der Beethoven-Sinfonien mit den Wiener Philharmonikern von 1977-79 kann daher als eine Referenzaufnahme für eine besonders romantische Beethoven-Interpretation angesehen werden, lebhaft, dynamisch und ohne jeden Zweifel gelegentlich auch sehr überschwänglich. Dieser Überschwang macht sich v.a. in der Aufnahme der Eroica-Sinfonie bemerkbar, die selbst unbeteiligte Hörer mitreißen dürfte. Diese Aufnahme sei daher jedem Beethoven-Anhänger ans Herz gelegt, nicht zuletzt, weil sie auch klanglich Standards setzt.
Hier geht es zur Referenzaufnahme der Beethoven-Sinfonien mit Bernstein von 1977-79.
Beethoven-Sinfonien, Referenzaufnahme 3: Norrington (2003-4)
 Norringtons Aufnahme als Referenzaufnahme zu bezeichnen ist zweifelsfrei nicht unstrittig. Dennoch sei Norringtons Aufnahme von 2003/4 hier als eine Referenzaufnahme der Beethoven-Sinfonien im Hinblick auf eine historische Aufführungspraxis genannt. Denn obwohl, wie Claus Spahn in einem Interview mit Norrington in DIE ZEIT vom 29.3.2009 feststellte, seit einigen Jahren eine Vielzahl von Aufnahmen den Markt überschwemmen, die der historischen Aufführungspraxis verpflichtet sind, so ist es doch Norringtons Einspielung, die in dieser Hinsicht die Lawine erst ins Rollen gebracht hat. Norrington sagt zu seiner Aufnahme: „Wenn Beethoven mit der richtigen Orchestergröße, in der richtigen Sitzordnung, mit den richtigen Tempi und der angemessenen Gestik für die Musik des 18. Jahrhunderts gespielt wird, klingt er so. Dann klingt Beethoven wie Beethoven. Man muss ihn nicht »interpretieren«, wie es Furtwängler oder Karajan getan haben. Man muss ihn sich nicht vornehmen, um etwas anderes aus ihm zu machen.“ (DIE ZEIT)
Norringtons Aufnahme als Referenzaufnahme zu bezeichnen ist zweifelsfrei nicht unstrittig. Dennoch sei Norringtons Aufnahme von 2003/4 hier als eine Referenzaufnahme der Beethoven-Sinfonien im Hinblick auf eine historische Aufführungspraxis genannt. Denn obwohl, wie Claus Spahn in einem Interview mit Norrington in DIE ZEIT vom 29.3.2009 feststellte, seit einigen Jahren eine Vielzahl von Aufnahmen den Markt überschwemmen, die der historischen Aufführungspraxis verpflichtet sind, so ist es doch Norringtons Einspielung, die in dieser Hinsicht die Lawine erst ins Rollen gebracht hat. Norrington sagt zu seiner Aufnahme: „Wenn Beethoven mit der richtigen Orchestergröße, in der richtigen Sitzordnung, mit den richtigen Tempi und der angemessenen Gestik für die Musik des 18. Jahrhunderts gespielt wird, klingt er so. Dann klingt Beethoven wie Beethoven. Man muss ihn nicht »interpretieren«, wie es Furtwängler oder Karajan getan haben. Man muss ihn sich nicht vornehmen, um etwas anderes aus ihm zu machen.“ (DIE ZEIT)
Hier geht es zur Referenzaufnahme der Beethoven-Sinfonien mit Norrington von 2003/4.
Weitergehende Empfehlungen
Wie bereits gesagt, ist es bei den Beethoven-Sinfonien nicht leicht, eine verbindliche Referenzaufnahme auszuwählen. Und auch die Vorstellung von drei solcher Referenzaufnahmen kann nicht als erschöpfend angesehen werden. Daher seien hier der Vollständigkeit halber noch drei weitere Aufnahmen aufgelistet, die höchste Beachtung gefunden haben und sicherlich auch von einigen Kritikern als eigentliche Referenzaufnahmen der Beethoven Sinfonien betrachtet werden:
- Beethoven-Sinfonien, Referenzaufnahme 4: Furtwängler
- Beethoven-Sinfonien, Referenzaufnahme 5: Kleiber (Link geht auf die Aufnahme der 5. und 7. Symphonie)
- Beethoven-Sinfonien, Referenzaufnahme 6: Wand
[Bildnachweis: graz – graffiti :: beethoven. Von southtyrolean, via flickr.com. Lizenz: CC BY 2.0 – Link zum Bild]

Ich kann leider nicht mit der hier angegebenen Reihenfolge übereinstimmen. Die älteren Aufnahmen von Beethovens Symphonien sind durchweg zu langsam gespielt worden. Meine Referenzaufnahmen von Beethovens Symphonien sind die Einspielung von Sir John Eliot Gardiner mit dem Orchestre Revolutionnaire et Romantique und natürlich die kürzliche Einspielung von Paavo Järvi mit der Kammerphilharmonie Bremen.
Karajan überlegen ist die Aufnahme der Neunten von 1958 mit Ferenc Fricsay und den Berliner Philharmonikern. Eine schlanke, dynamische, in sich sehr stimmige Einspielung. Ungewöhnlich gut auch die 2006er-Version vom Minnesota Orchestra unter Osmo Vänskä – eine moderne, runde und klangtechnisch brillante Version.
Die Einspielung unter Fricsay gefällt mir noch heute. Ob sie einer anderen Einspielung überlegen ist, weiß ich nicht. Ich habe mich damals immer gefragt, warum nur noch LPs unter Karajan in meiner Stadt auf dem Markt waren. Ich hatte damals das Gefühl, dass Karajan gute Förderer hatte. Die Einspielung von Beethovens 4. unter Karajan war damals für mich ein Schock. Dann hörte ich Bruckners Achte unter Karajan, und ich revidierte mein Urteil über diesen Dirigenten.
Ich wundere mich sehr, daß die einmaligen, mittlerweile historischen, Aufnahmen von Rene Leibowitz hier völlig unter den Tisch gefallen sind. Die Aufnahmen von 1961 gelten auch heute noch als interpretatorische Meisterwerke, da Beethoven hier erstmals entschlackt und dynamisch genau interpretiert wurde. Hören sie als Anspieltipp in die 5. Synfonie hinein und sie werden feststellen, daß sie die noch nie so frisch und mitreissend gehört haben.
An alle Beethoven Liebhaber, … Mir völlig unverständlich, wie die grandiosen Einspielungen von Pierre Monteux hier nicht mal erwähnt werden ! Keiner der hier genannten Dirigenten (Karajan kommt in die Nähe), steigert das herrliche Thema des zweiten Satzes so intensiv wie er ! Einfach perfekt, ..
…des zweiten Satzes welcher Sinfonie denn?
Wenn wir davon sprechen wollen, dass Norrington mit seinem Zyklus die Lawine der historisierenden Aufführungspraxis, was Beetoven angeht, ins Rollen gebracht habe, dann muss sich das auf seine Gesamtaufnahme mit den London Classical Players aus den 80er Jahren beziehen. Die hier besprochene Gesamtaufnahme von 2003/2004 ist mit dem RSO Stuttgart entstanden, keinem Originalklang-Ensemble. Sicher lässt Norrington seinen Erfahrungsschatz als Originalklang-Pionier der 2. Generation hier bei der Arbeit mit modernem Instrumentarium einfliessen (Stichwort „The Stuttgart sound“), allein, historisierende Aspekte hat vor ihm beispielsweise bereits David Zinman mit dem Tonhalle-Orchester Zürich bei deren Beethoven-Totale umgesetzt.
Auch ich bin ein Freund der Leibowitz-Gesamtaufnahme, die immer noch als Geheimtip gilt – müsste ich mich für nur eine als Referenz entscheiden, dann wäre es diese.
Ich persönlich mag die Interpretation von Masur auch sehr gerne. Wegen ihm hab ich mich überhaupt wieder mit Beethoven befasst. Am Schluss fehlt uns der Beethoven leibhaftig um zu entscheiden, wie es „richtig“ geklungen hat.
Für mich bleiben die „lahmarschigen“ Masur Aufnahmen die Referenz.
Mir fehlen in dieser Übersicht auf jeden Fall die Gesamtaufnahmen von Rene Leibowitz. Ich finde, die sind doch (für die damalige Zeit) revolutionär in ihrem Gestus und vor allem unter Beachtung der umstrittenen Metronomangaben. Besonders die 6. Sinfonie ist beispiellos, gerade im 2. Satz.
Leibowitz fehlt in der Tat – aber auch Krips mit dem LSO von 1960, eine deutlich langsamere Interpretation, aber wunderbar dynamisch und transparent. Das liegt zum Teil auch an der Aufnahmetechnik, die damals von Everest auf 35mm-Band gespeichert wurde.