Die Gattung des Streichquartetts gilt nicht ohne Grund als Königsdisziplin der Kammermusik (wie man landauf, landab liest; in diesem Fall ist eine Wiederholung dieses Aperçus jedoch statthaft): In der konzentrierten Besetzung von zwei Violinen, Viola und Violoncello offenbart sich eine außerordentliche klangliche und strukturelle Dichte, die seit der Wiener Klassik, also seit den Werken Haydns, Mozarts und vor allem Beethovens die Komponist*innen aller Epochen zu Höchstleistungen herausgefordert hat.
Und da sind wir auch schon mitten im „Problem“: Gerade weil das Repertoire von einigen überragenden Namen dominiert wird (Beethoven als der Übervater des Streichquartetts, der unübertroffene Meister), bleibt eine Vielzahl großartiger Streichquartette im Schatten – und das völlig zu Unrecht.
Denn abseits des sogenannten Streichquartett-Kanons finden sich Quartette von bemerkenswerter Ausdruckskraft, kompositorischer Raffinesse und durchaus auch von stilistischer Eigenständigkeit.
In dieser dreiteiligen Blogpost-Reihe sollen solche weniger bekannten, aber künstlerisch lohnenden Werke in den Blick genommen werden – Werke, die nur selten auf den Standardspielplänen erscheinen (und wenn überhaupt, dann höchstens als „kuriose“ Beigabe zu einem ansonsten eher typischen Streichquartett-Programm). Ich möchte zeigen, dass diese Werke in keiner ernsthaften Auseinandersetzung mit dem Genre fehlen sollten.
Dieser erste Teil der Artikelreihe widmet sich drei ausgewählten Kompositionen aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die jede auf ihre Weise neue Perspektiven auf die Gattung eröffnen. Von „Referenzaufnahmen“ wird bei diesen Streichquartetten nur bedingt die Rede sein können, da viele der genannten Werke nur selten überhaupt aufgenommen worden sind. Dennoch habe ich mich bemüht, immer eine sehr charakteristische Aufnahme ausfindig zu machen, die im Vergleich andere Aufnahmen in den Schatten stellt.
Alexander Borodin: Streichquartett Nr. 2 in D-Dur (1881)
Alexander Borodin, im Hauptberuf Chemiker (was man seinen Kompositionen allerdings keineswegs anhört; der kleine Scherz sei mir gestattet), gehört zu jener schillernden Gruppe russischer Komponisten, die unter dem Etikett „Gruppe der Fünf“ firmierten – ein Kreis, der sich programmatisch dem westeuropäischen Einfluss verweigerte und dennoch (oder gerade deshalb) einige der reizvollsten Werke der russischen Romantik hervorbrachte. Die weithin bekannten Komponisten Balakirew, Mussorgski und Rimski-Korsakow gehörten diesem Kreis ebenso an, wie der (zumindest im heutigen deutschsprachigen Konzertbetrieb) im Grunde völlig unbekannte Komponist César Cui. Borodin verfolgte zeitlebens das Ziel, eine eigenständige russische Musikästhetik jenseits der westlichen Tradition zu entwickeln.
Sein kompositorisches Œuvre ist vergleichsweise schmal, aber darum um so konzentrierter. Neben dem berühmten sinfonischen Tongemälde Eine Steppenskizze aus Mittelasien und seinen beiden vollendeten Sinfonien (eine dritte blieb unvollständig) ist es vor allem die Oper Fürst Igor, an der er über viele Jahre arbeitete, die seinen Namen bekannt gemacht hat – nicht zuletzt wegen der Polowetzer Tänze, die auch außerhalb des Opernkontexts Karriere machten und auch heute noch gerne gespielt werden.
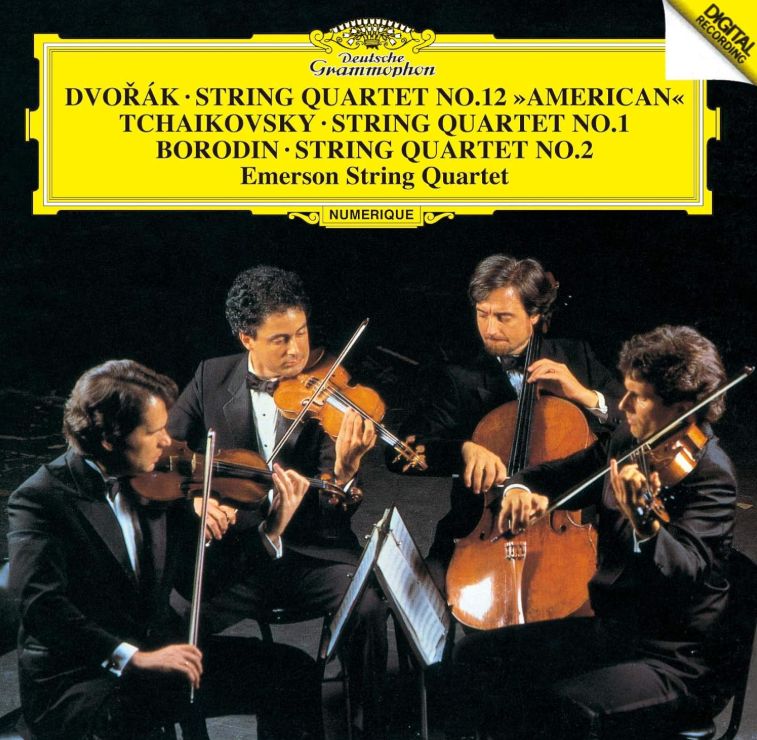
Dass ein Komponist mit dieser Neigung zum großen, farbenreichen Format sich zugleich in der kammermusikalischen Miniatur zu behaupten wusste, zeigt das Streichquartett Nr. 2 in D-Dur mit überraschender Klarheit. Es entstand – wie glaubwürdig kolportiert wird – als musikalisches Geschenk an seine Frau und ist in seinem Tonfall durchweg von kantabler Innigkeit und melodischer Großzügigkeit geprägt. Das berühmte Notturno im dritten Satz, regelmäßig als sentimentales Klangzitat in Film und Fernsehen verwendet (oder, je nach Perspektive, ausgeschlachtet), droht fast zu verdecken, wie ausgewogen und durchgearbeitet das gesamte Quartett ist – ein Werk, das Romantik nicht als Schwärmerei, sondern als kompositorische Disziplin versteht. Auch der unverkennbar slawische Tonfall, der das Werk zugleich distinguiert und unmittelbar zugänglich macht, sollte Klassik-Liebhabern eine Empfehlung sein.
Empfehlung für die Aufnahme: Das Emerson String Quartet liefert eine technisch makellose, zugleich nuancierte Interpretation, die das lyrische Potential des Werks mit beeindruckender Klangkultur zur Geltung bringt – erhältlich sowohl physisch als auch auf gängigen Streaming-Plattformen (hier der Link zu Spotify). Aufgenommen für die DGG im Jahre 1984.
Fanny Hensel (geb. Mendelssohn) – Streichquartett in Es-Dur (1834)
Fanny Hensel (1805–1847), geborene Mendelssohn, war eine der bemerkenswertesten Komponistinnen ihrer Zeit – nicht nur, weil sie sich im Schatten ihres berühmten Bruders Felix Mendelssohn Bartholdy als eigenständige musikalische Persönlichkeit behauptete, sondern auch, weil sie, trotz gesellschaftlicher Einschränkungen, ein Werk von beachtlicher Tiefe und Vielfalt hinterließ. Ihre über 450 Kompositionen reichen von Liedern und Klavierstücken bis hin zu großformatiger Vokal- und Instrumentalmusik – darunter auch das 1834 entstandene Streichquartett in Es-Dur, ihr einziges Werk für diese Gattung.
Wer hier salonhafte Gefälligkeit oder epigonale Anleihen beim Bruder erwartet, wird überrascht – und womöglich beschämt – sein. Das Quartett ist kein bloßes Zeugnis weiblicher Bildungserwartung, sondern ein künstlerisch ambitioniertes Werk, das sich formal und expressiv souverän innerhalb der Gattung behauptet. Es bewegt sich auf dem Boden der klassischen Struktur – viersätzig, klar disponiert –, erlaubt sich aber harmonische Kühnheiten und Ausdruckssprünge, die den Hörer unweigerlich aufmerken lassen. Ich habe das Werk fünf Klassikliebhaber*innen vorgespielt – zwei tippten auf Brahms, einer auf Felix Mendelssohn. Niemand lag richtig.
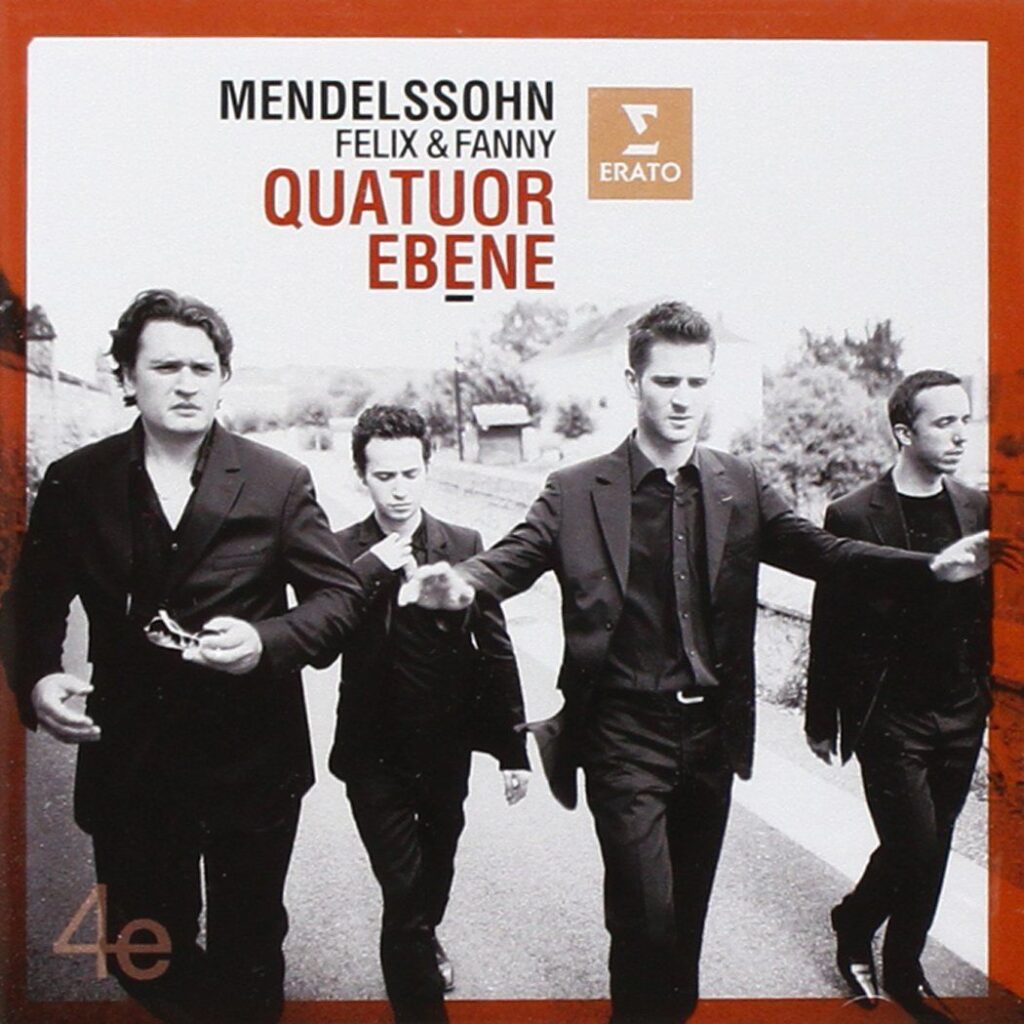
Besonders der erste Satz (Adagio ma non troppo), mit seinen schroffen Kontrasten und seiner eindringlichen Chromatik, ist ein Beispiel für die Ernsthaftigkeit, mit der Hensel hier musikalisch spricht. Das lyrische Adagio entfaltet eine stille Innigkeit, frei von jedem Dekor. Verspielt das Allegretto, zweiter Satz, sicherlich das charakteristischste Stück dieses Streichquartetts; flehend romantisch der dritte Satz (Romanze). Schließlich ein Allegro molto zum Abschluss, das eine Mozart’sche Eleganz mit einer Beethoven’schen Dringlichkeit verbindet.
Empfehlung für die Aufnahme: Das Merel Quartet hat eine schöne Aufnahme hingelegt (Spotify). Aber dem Quatuor Ébène gebührt der größte Dank für eine klare und intensive Einspielung dieses Werks. Mit viel Gespür für Struktur und Dramatik liefern sie eine klanglich transparente, emotional dichte Interpretation, die dem Werk gerecht wird und seine leisen Radikalitäten hörbar macht. Hier ist es auf Spotify zu hören. Hier gibt es den physischen Datenträger.
Grażyna Bacewicz: Streichquartett Nr. 4 (1951)
Grażyna Bacewicz (1909–1969) ist heute – wenn überhaupt – in Konzertprogrammen meist als Fußnote zur polnischen Musik des 20. Jahrhunderts präsent, auch wenn durchaus berühmte Interpret*innen ihre Werke immer wieder aufführen und einspielen (besonders empfehlenswert: Krystian Zimermans Aufnahme ihrer Klaviersonate sowie der Klavierquintette) Dabei gehörte sie zu den zentralen Gestalten einer Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen Tradition, Sozialistischer Kulturpolitik und avantgardistischer Öffnung navigierte. Als ausgebildete Geigerin (u. a. bei Carl Flesch, der niemanden geringeren als Bacewiczs Landsmann Henryk Szeryng ausbildete) schrieb sie ihre Kammermusik stets mit einem ausgeprägten Gespür für instrumentale Idiomatik – nichts klingt konstruiert, alles ist „spielend“ gedacht, oft mit motorischer Energie durchzogen.
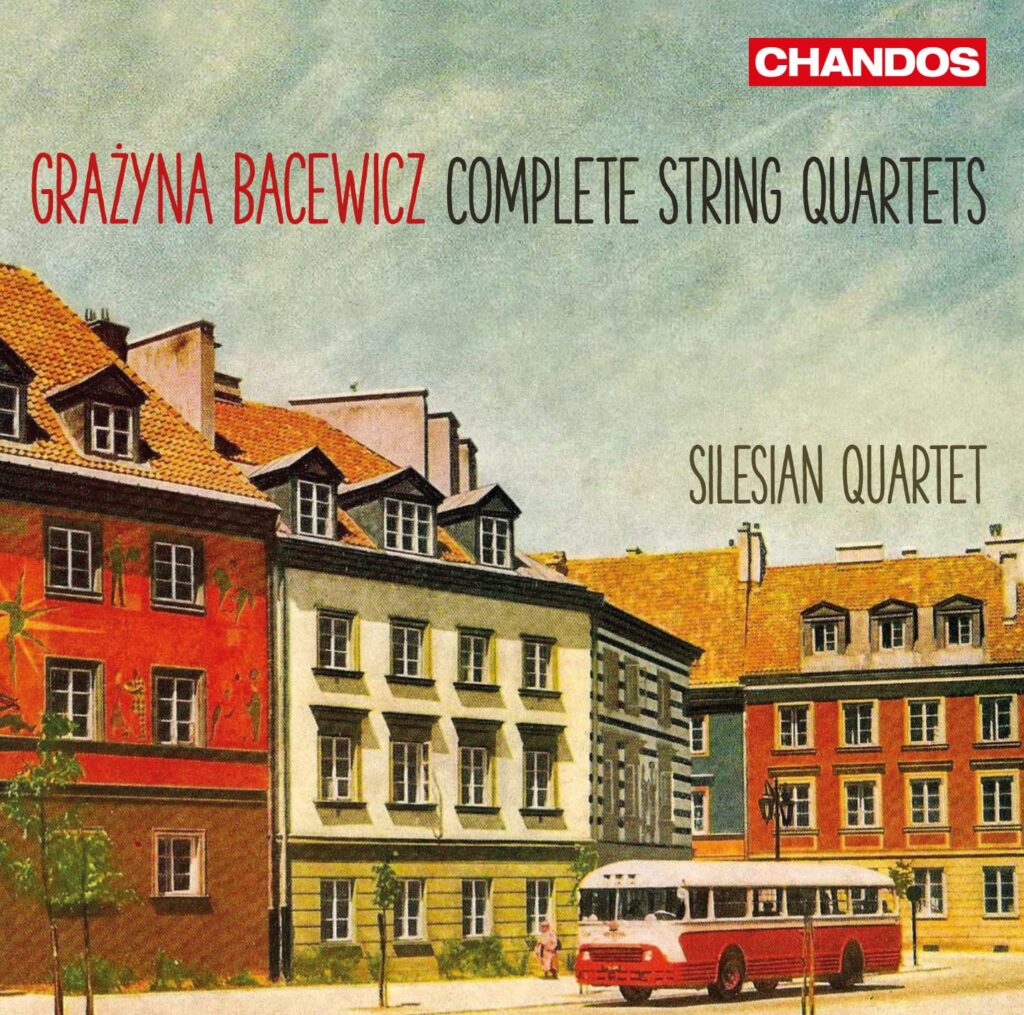
Ihr viertes Streichquartett, komponiert 1951, steht exemplarisch für diese Ästhetik: ein dreisätziges Werk von rhythmischer Prägnanz, stilistischer Vielschichtigkeit und formaler Konzentration. Elemente neoklassizistischer Strenge treffen hier auf eine moderne, zuweilen fast tänzerische Expressivität (besonders hörbar im 3. Satz, dem Allegro giocoso, dessen heiter-tänzelnder Klang stellenweise an einen Ländler von Schubert erinnert). Es handelt sich um ein Werk, das zwischen den Polen von Kontrolle und Impuls oszilliert, dabei aber nie ins Akademische kippt. Es brachte ihr den Ersten Preis beim Concours International pour Quatuor a Cordes in Lüttich 1951 ein.
Empfehlung für die Aufnahme: Wie schon erwähnt, ist Grażyna Bacewicz eine Unbekannte. Entsprechend übersichtlich ist die Zahl der Einspielungen ihrer Werke. Da machen die Streichquartette keine Ausnahme. Das Silesian String Quartet, das sich mit besonderem Engagement dem polnischen Repertoire widmet, bietet jedoch eine klanglich differenzierte, rhythmisch vitale Interpretation dieses Stücks, die absolut hörenswert ist und am ehesten den Titel einer „Referenzaufnahme“ verdient. Hier ist es auf Spotify zu hören. Hier kann man die absolut empfehlenswerte Aufnahme erwerben.
